Monitoringbericht: Festhalten am Kurs in Richtung Energieautonomie
Monitoringbericht zur Energieautonomie+ 2030
Seit 2005, dem Startjahr des Energieautonomie-Prozesses, konnten die TreibhausgasEmissionen in Vorarlberg um 24 Prozent reduziert werden. Und das, obwohl im selben
Zeitraum die Bevölkerungszahl um 13 Prozent (rund 47.000 Personen) gestiegen ist. Das zeigt
der neue Monitoringbericht zur Energieautonomie+ 2030, der auf Bundes- und Landesebene
qualitätsgeprüfte Energie- und Emissionsdaten für das Jahr 2023 präsentiert. „Der
eingeschlagene Kurs stimmt und muss auch in Zukunft beibehalten werden“, bekräftigen
Landeshauptmann Markus Wallner und Energielandesrat Daniel Allgäuer ihren Willen,
weiterhin die nötigen Schritte in Richtung Energieautonomie und Stärkung des Klimaschutzes
zu setzen.

Im Bilanzjahr 2023 konnte der Energieverbrauch in Vorarlberg zu 48 Prozent aus heimischen
Energiequellen gedeckt werden. Der Anteil Erneuerbarer an der Stromversorgung lag bei 95
Prozent. Das Jahr war geprägt von einer milden Witterung, anhaltend hohen Energiepreisen und
einer Vielzahl von Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase. Von 2022 auf 2023 sanken die
Emissionen um 4,9 Prozent, hauptverantwortlich hierfür waren die Emissionsrückgänge im
Gebäudesektor und beim Verkehr. Der Einsatz fossiler Energieträger nahm von 2005 bis 2023
signifikant ab: Heizöl wird um 71 Prozent weniger eingesetzt und Gas um 7 Prozent weniger.
Mit einer Produktion von 2.523 GWh aus Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse konnten
rund 95 Prozent der Netzabgabe elektrischer Energie (ohne Transportverluste) bilanziell aus
heimischen Erzeugungsanlagen v. a. aus Wasserkraftanlagen gedeckt werden. Damit liegt man
bereits über dem geplanten Zielwert (89 Prozent). Bei der Photovoltaik, wo bereits auch Daten
für 2024 verfügbar sind, wurde das Ausbauziel der Strategie Energieautonomie+ für 2030 von 330 MW Photovoltaik schon erreicht – somit fünf Jahre früher als geplant.
Noch im Jahr 2025 soll die Energiestrategie „Energieautonomie+ 2030“ des Landes Vorarlberg
einem Update unterzogen werden, bei dem auf die jüngsten Entwicklungen am Energiemarkt wie
z.B. den wachsenden Bedarf an Stromspeicherkapazitäten und geänderte regulatorische
Vorgaben von Bundes- und EU-Ebene eingegangen wird, wie z.B. die weitere Beschleunigung des
Ausbaus erneuerbarer Energie.

Die Energieautonomie kann nur gemeinsam mit der Bevölkerung und der Wirtschaft gelingen.Landeshauptmann Markus Wallner
Der Ausbau und die Nutzung von erneuerbaren Energien für Energieversorger, Unternehmen und Haushalte soll vereinfacht werden – konkret mit dem Gesetz über Erleichterungen für Vorhaben der Energiewende, das zu Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode im Landtag beschlossen wurde.
„Mit dem neuen Gesetz sollen Verfahren beschleunigt, Bürokratie reduziert und weitere Erleichterungen beim Bau von Erzeugungsanlagen für sauberen Strom und saubere Wärme geschaffen werden“, betont Wallner. Haushalte profitieren unmittelbar von den neuen Regelungen, so können zukünftig Solar- und PV-Anlagen unter bestimmten Voraussetzungen bewilligungsfrei an Geländern von Balkonen und Terrassen errichtet werden.

Neben der Verfahrensbeschleunigung und Entbürokratisierung werden Investitionen in die Infrastruktur, darunter das Lünerseewerk II und der Netzausbau, gezielt vorangetrieben.Energielandesrat Daniel Allgäuer
In der längerfristigen Betrachtung 2005-2023 haben sich wichtige Einflussgrößen auf den
Energieverbrauch in Vorarlberg sehr dynamisch entwickelt:
- Bevölkerung: +13 Prozent (+ca. 47.000 Personen)
- Zugelassene PKW: +31 Prozent (+ca. 53.000 PKW)
- Wohnfläche: +23 Prozent (+4 Millionen m² Bruttogeschoßfläche)
- Bruttoregionalprodukt: +97 Prozent (+10 Milliarden Euro)
- Produktionsindex der Wirtschaft: +81 Prozent (2005 = 100 Prozent)
- Heizgradtage: -22 Prozent
Hauptziele der Energieautonomie+ 2030
Landeshauptmann Wallner und Landesrat Allgäuer unterstreichen die in der Energieautonomie+ 2030 beschlossenen Ziele, die sich mit der Formel 50-50-100 umschreiben lassen: • 50 Prozent Anteil heimischer erneuerbarer Energieträger am Endenergiebedarf • 50 Prozent Reduktion der Treibhausgase zum Vergleichsjahr 2005 • 100 Prozent Anteil erneuerbarer Energie an der Stromversorgung
50 Prozent Anteil heimischer (erneuerbarer) Energieträger am Endenergiebedarf bis 2030
In Vorarlberg wurden im aktuellen Bilanzjahr 9.056 GWh an Endenergie (exkl. Kraftstoffexport)
verbraucht und damit 2 Prozent weniger als im Basisjahr 2005.
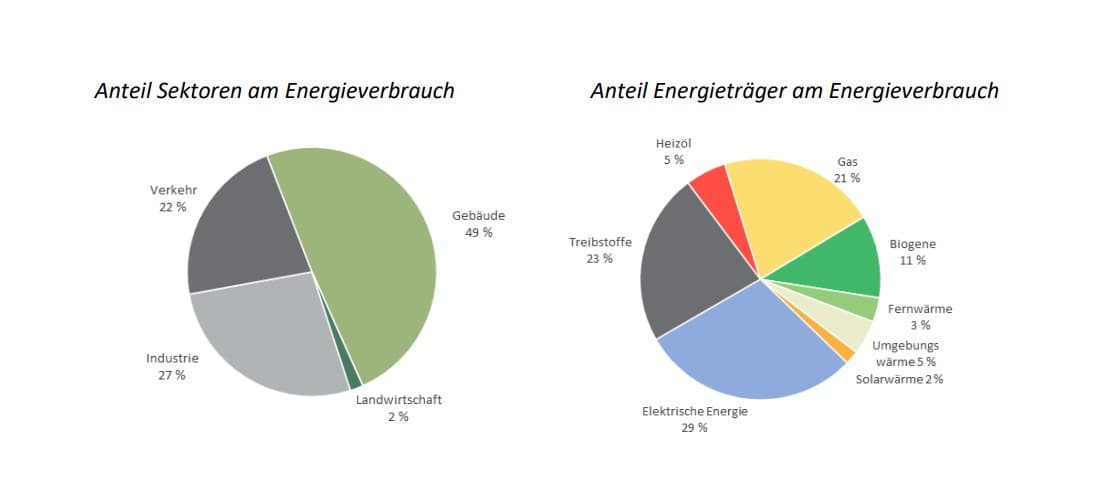
Am meisten Energie brauchen die Gebäude (49 Prozent) und die Industrie (27 Prozent).
Wichtigster Energieträger ist Strom (29 Prozent), gefolgt von Treibstoffen (23 Prozent) und Gas
(21 Prozent). Der Energieverbrauch konnte zu 48 Prozent aus heimischen Energiequellen gedeckt
werden (Etappenziel waren 46 Prozent). Die größte Importabhängigkeit besteht im Sektor
Verkehr gefolgt von der Industrie.
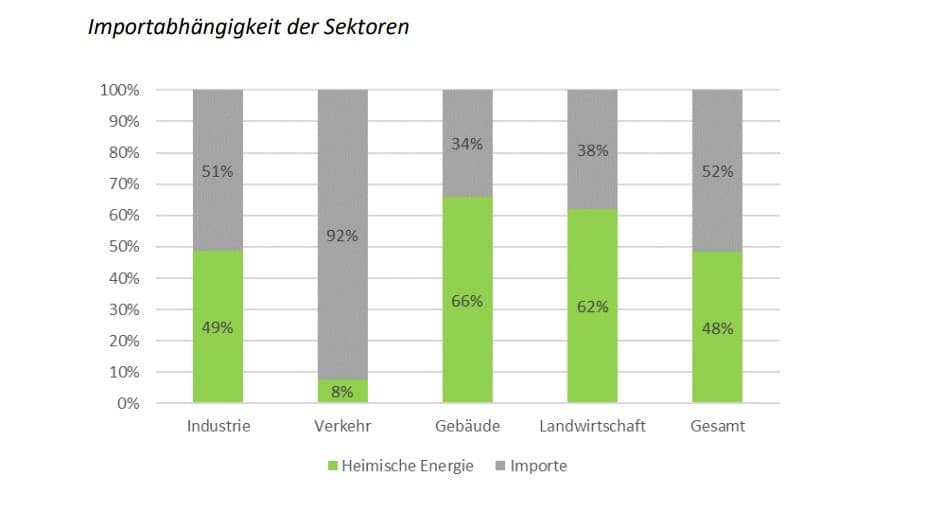
50 Prozent Reduktion der Treibhausgase zum Vergleichsjahr 2005
Im Bilanzjahr 2023 wurden in Vorarlberg inkl. Kraftstoffexport Treibhausgase im Ausmaß von
1,83 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalent ausgestoßen. Damit lagen die Treibhausgas-Emissionen um 24
Prozent unter dem Wert von 2005. Vorarlbergs Anteil an den österreichischen TreibhausgasEmissionen (ohne Emissionshandelsbereich) beträgt 4,1 Prozent.
Von 2022 auf 2023 sanken die Emissionen um 4,9 Prozent, hauptverantwortlich hierfür waren
die Emissionsrückgänge im Gebäudesektor und beim Verkehr. Im Gebäudesektor nahm der
Einsatz fossiler Brennstoffe (Heizöl und Erdgas) in Privat- und in Dienstleistungsgebäuden im
Vergleich zum Vorjahr als Folge der zunehmenden Umstellung auf klimafreundliche
Heizungssysteme, der milden Witterung sowie der anhaltend hohen Energiepreise ab. Der
Rückgang im Verkehr ist maßgeblich auf den merklich reduzierten Dieselabsatz bei schweren
Nutzfahrzeugen zurückzuführen. Am meisten Treibhausgase verursachte der Verkehr (43
Prozent). Die Emissions-Höchstmenge laut Zielpfad wurde um 6 Prozent überschritten.
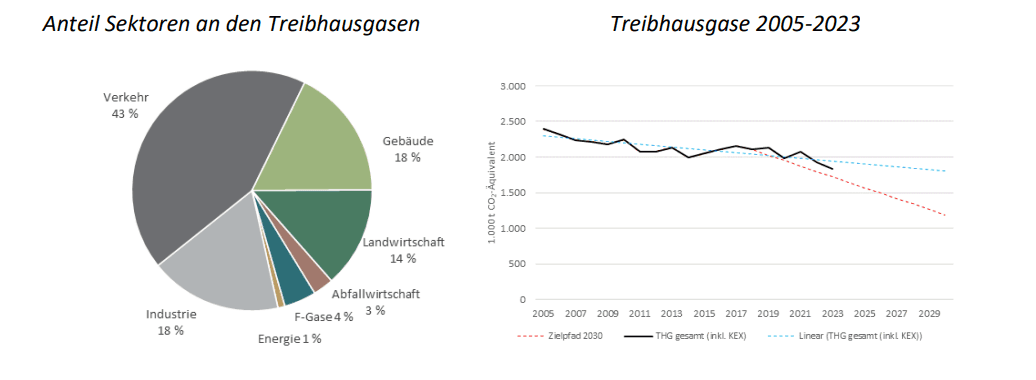
Hauptziel: 100 Prozent Anteil erneuerbare Energie an der Stromversorgung in der Jahresbilanz
Im Jahr 2023 wurden in Vorarlberg 2.667 GWh an elektrischer Energie an Endkund:innen
abgegeben und damit ca. 6 Prozent mehr als im Jahr 2005. Rund 2/3 des Stroms in Vorarlberg
wird im Dienstleistungssektor inkl. öffentliche Dienstleistungen und von der Industrie
konsumiert. Mit einer Produktion von 2.523 GWh aus Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse
konnten rund 95 Prozent der Netzabgabe elektrischer Energie (ohne Transportverluste) bilanziell
aus heimischen Erzeugungsanlagen v. a. aus Wasserkraftanlagen gedeckt werden (Zielwert 89
Prozent).
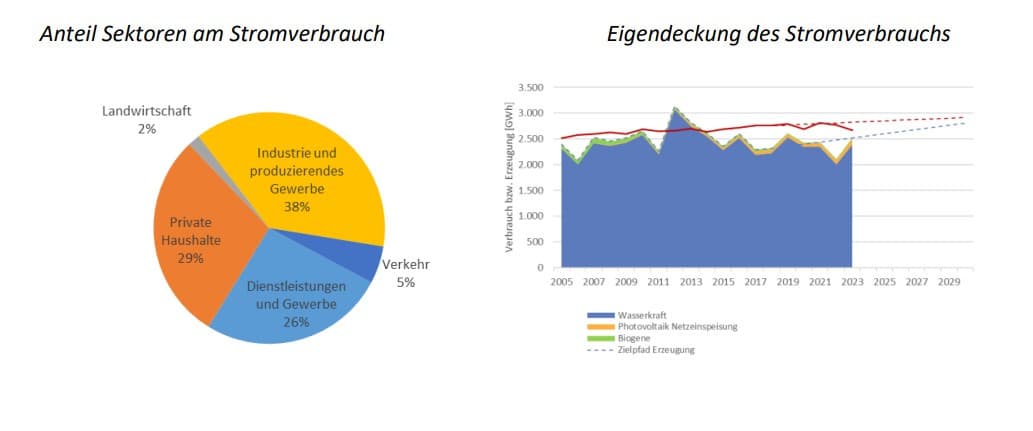
Während die Wasserkraft aus natürlichem Zufluss seit 2005 tendenziell stagniert bzw. vom
Wasserdargebot des jeweiligen Jahres abhängt, steigt die Erzeugung aus Photovoltaik stark an.
Sektorale Zielsetzungen Gebäudesektor
Die Treibhausgase-Emissionen der Gebäude für Heizen und Warmwasser waren 2023 um 51
Prozent geringer als 2005. Nach einer Stagnationsphase 2014 -2021 nahmen die Emissionen die
letzten zwei Jahre deutlich ab. Im Neubau sind mehr als 97 Prozent der Heizsysteme
klimafreundlich, bei größeren Sanierungen sind es mehr als 80 Prozent. Beim Gesamtbestand an
Gaskesseln gibt es – basierend auf den alle zwei Jahre stattfindenden Messungen der
Kaminkehrer – erstmals eine Trendumkehr. Eine Herausforderung für die Energieautonomie
stellen die rund 36.000 Gaskessel und 23.000 Ölkessel dar mit denen noch rund 60 Prozent der
Gebäude beheizt werden. Rund 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen Vorarlbergs gehen auf
diese rund 60.000 fossilen Kessel zurück.
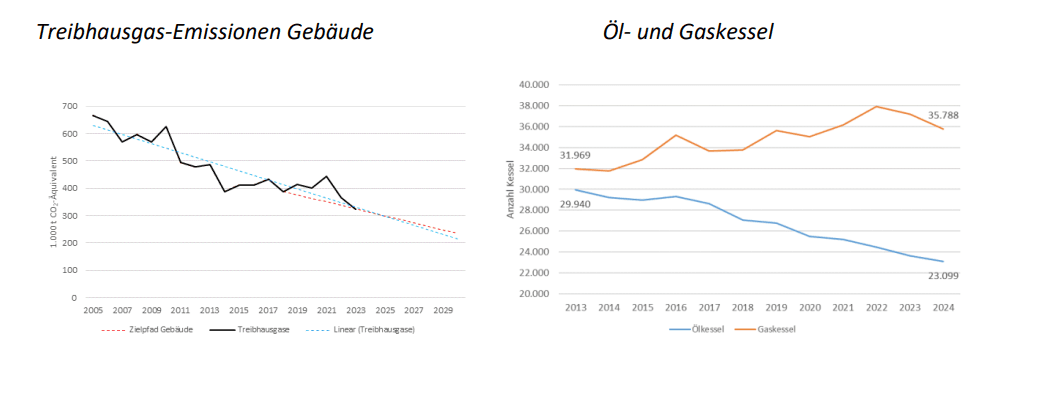
Sektorale Zielsetzungen Verkehr
Die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrssektors waren 2023 um 20 Prozent geringer als
2005. Modellierungen deuten darauf hin, dass die Abnahme vor allem im Bereich des
Kraftstoffexports stattfand und die Emissionen des Inlandsverkehrs in der Tendenz nach wie vor steigen. Demgegenüber stehen große Erfolge im Umweltverbund (> 50 Prozent aller Wege zu
Fuß, mit Fahrrad oder im ÖV), im öffentlichen Verkehr (2024 wurden 90.000 Jahreskarten
maximo und domino verkauft) und bei alternativen Antrieben für PKW (mit rd. 11.000 E-Autos
und rd. 16.000 Hybriden beträgt der Anteil dieser beiden Antriebsarten am Bestand 12 Prozent).
Bei der Ladeinfrastruktur kommen rund 300 öffentliche Ladepunkte auf 100.000 Einwohner bzw.
teilen sich 8,9 E-PKW einen öffentlichen Ladepunkt.
Sektorale Zielsetzungen Industrie
Die Industrie hat im Jahr 2023 insgesamt 2.457 GWh an Endenergie verbraucht und damit um
7 Prozent mehr als 2005. Der Produktionsindex stieg im Zeitraum 2005-2023 um 81 Prozent. Die
wichtigsten Energieträger in der Industrie im Jahr 2023 waren Gas (41 Prozent) und elektrische Energie (39 Prozent). Damit besteht nach wie vor eine hohe Auslandsabhängigkeit von potenziell teuren Energieträgern, gerade im Winter. Der Zielpfad der Energieautonomie für den Energieverbrauch wurde eingehalten, jener für den Anteil erneuerbarer Energie bzw. die
Treibhausgase nicht.
Um die in den Zielsetzungen der Energieautonomie für die Industrie hinterlegte Entkoppelung
von Energieverbrauch und Treibhausgas-Emissionen zu erreichen, sind zusätzliche
Anstrengungen zum Ersatz von Gas notwendig.
Ausgewählte Indikatoren
Für einige Indikatoren sind bereits Werte für 2024 verfügbar. Es wird jeweils der aktuellste
Wert verwendet.
